Außerordentliche Wirtschaftshilfe
Servicehotline und E-Mail-Beratung
Über den gesamten Zeitraum der Corona-Pandemie gab es für Soloselbständige und Unternehmen zahlreiche Hilfsprogramme. Häufig ist eine nachträgliche Überprüfung bzw. Endabrechnung erforderlich. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte direkt an die jeweiligen Ansprechpartner.
Soforthilfe Corona: Erreichbarkeit der Servicehotline werktags, zwischen 9-11 und 13-15 Uhr, unter 089 57907066 sowie per E-Mail an info[at]soforthilfecorona.bayern[dot]de.
Neustarthilfen, Überbrückungshilfen und außerordentliche Wirtschaftshilfen (November-/Dezemberhilfe): Erreichbarkeit der Servicehotline Montag bis Donnerstag von 8-18 Uhr sowie Freitag von 8-16 Uhr, unter 089 51161111 sowie per E-Mail an wirtschaftshilfen[at]muenchen.ihk[dot]de.
Soloselbständigenprogramm für Künstlerinnen und Künstler sowie Angehörige kulturnaher Berufe: Über die Kontaktmöglichkeiten informiert das StMWK.
Mit Beschluss vom 28. Oktober 2020 hatten Bund und Länder die temporäre Schließung („Lockdown light“) einzelner Branchen beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Für die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, Selbständigen, Vereine und Einrichtungen gewährt der Bund eine außerordentliche Wirtschaftshilfe (Novemberhilfe), um sie für finanzielle Ausfälle zu entschädigen.
Mit Beschluss vom 25. November 2020 hatten Bund und Länder vereinbart, die finanzielle Unterstützung für vom Lockdown betroffene Unternehmen auch im Dezember fortzuführen (Dezemberhilfe).
Antworten auf die häufig gestellten Fragen zur „Novemberhilfe“ und „Dezemberhilfe“ finden Sie auf der Website des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
Für die Unternehmen und Soloselbständigen in Bayern, die schon vor dem am 2. November 2020 beginnenden bundesweiten Lockdown von einem Lockdown auf Kreisebene betroffen waren (Berchtesgadener Land, Rottal-Inn, Augsburg und Rosenheim) wurde die Novemberhilfe durch ein Landesprogramm, die „Bayerische Lockdown-Hilfe“, ergänzt.
Außerordentliche Wirtschaftshilfe
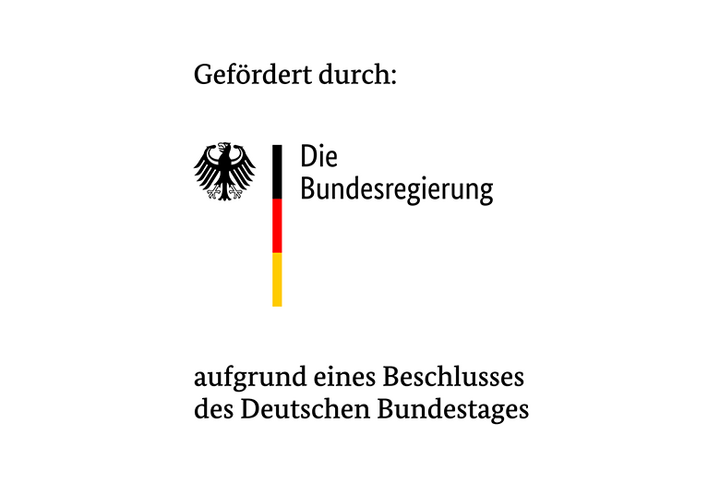
Hier finden Sie alle Informationen des Bundes zur November- und Dezemberhilfe.
Download
Richtlinien
- Oktoberhilfe: Richtlinie für die Gewährung einer Bayerischen Lockdown-Hilfe für die bereits vor November 2020 von regionalen Lockdowns betroffenen Landkreise Berchtesgadener Land und Rottal-Inn sowie die Städte Augsburg und Rosenheim
- Novemberhilfe: Richtlinie für die Gewährung von außerordentlicher Wirtschaftshilfe des Bundes für November 2020
- Dezemberhilfe: Richtlinie für die Gewährung von außerordentlicher Wirtschaftshilfe des Bundes für Dezember 2020


